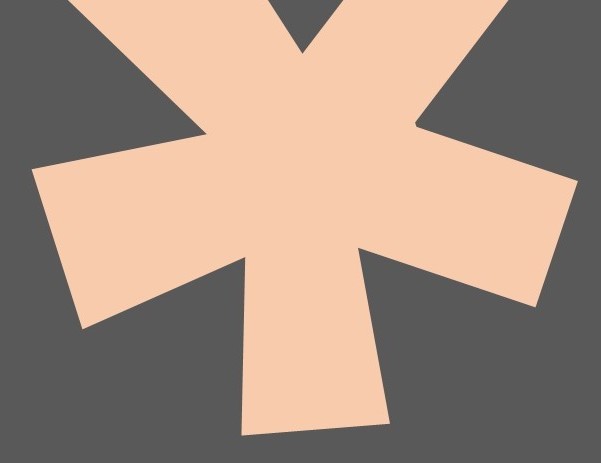Die Forschungsplattform "Neuverortung der Frauen- und Geschlechtergeschichte im veränderten europäischen Kontext. Vernetzung – Ressourcen – Projekte" wurde 2006 an der Universität Wien eingerichtet. Sie baute auf Ressourcen und Einrichtungen auf, die Frauen- und Geschlechterhistorikerinnen am Institut für Geschichte der Universität Wien erfolgreich initiiert haben.
Die Forschungsplattform lief bis Ende 2012.
Wichtigste Aufgabe der Forschungsplattform war die Arbeit im Hinblick auf intensivierte interfakultäre und interdisziplinäre Kooperation sowie auf eine verstärkte bzw. institutionalisierte internationale Vernetzung. Zu den primären Zielen gehörte weiters die Fokussierung auf eine methodisch abgesicherte europäische Frauen- und Geschlechtergeschichte, die den historiographischen Veränderungen und Herausforderungen seit 1989 Rechnung trägt: Das Wissen um nationale und regionale Geschichte hatte sich ebenso erweitert, wie sich die Perspektiven auf gemeinsame europäische Probleme verändert hatten.
Die Forschungsplattform stellte einige an der Universität Wien aufgebaute Instrumente und Einrichtungen zur Verfügung, die es erlaubten, diesen Prozess radikaler Veränderung zu kommentieren, Erinnerungen zu bewahren und transnationale Forschungsarbeiten in die Wege zu leiten.
Die drei Säulen der Forschungsplattform bildeten
- die Fachzeitschrift "L'HOMME. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft" und ihre beiden Schriftenreihen, in welcher die neuesten Forschungsergebnisse präsentiert und diskutiert werden,
- die "Sammlung Frauennachlässe" mit den Projekten "Sprache und Erinnerung in Frauentagebüchern des 20. Jahrhunderts" und "Liebe in Paarkorrespondenzen" (FWF)
- sowie der Ankündigungsweblog "Salon 21" als zentrales Instrument des Informationsaustausches und der Netzwerkbildung.
Alle drei bestehen weiterhin.
Weitere Informationen zur Forschungsplattform finden sich im Artikel: Edith Saurer, Michaela Hafner und Li Gerhalter, The Research Platform "Repositioning of Women's and Gender History” at the University of Vienna. In: Genre & Histoire, n°7 | Automne 2010
„Dies mein zweites Leben soll nicht gemordet werden.“ Elise Richter und ihre Tagebücher – eine Biografie von Christine Karner
Herausgegeben von Christa Hämmerle im Löcker Verlag Wien (2025) (Link)
Elise Richter wurde nicht nur zu einer Pionierin des ab 1897 schrittweise zugelassenen Frauenstudiums an der Universität Wien, sondern auch die erste habilitierte Wissenschaftlerin im deutschsprachigen Raum (1905/07) und eine weit über die Grenzen Österreichs hinaus anerkannte Romanistin. Im „Dritten Reich“ galt sie als „Rasse-Jüdin“; sie wurde entrechtet und schließlich mit ihrer Schwester Helene Richter im Oktober 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie elendiglich umkam.
In all diesen Jahren hat Elise Richter Tagebuch geführt und damit einen besonders reichhaltigen Quellenkorpus hinterlassen, der nun erstmals umfassend ausgewertet wird: Welche Ereignisse, Sichtweisen und Deutungen werden in diesen Aufzeichnungen erwähnt und reflektiert? Was schrieb Elise Richter darin über Freund*innen, Wegstreiter*innen, Kolleg*innen …, was über ihren mit vielen Hindernissen belegten Werdegang als Wissenschaftlerin? Und welche widersprüchlichen oder ambivalenten Positionierungen fallen dabei besonders auf, welche (inneren) Kämpfe und Konflikte werden manifest?
Das sind einige der Fragen, die in Christine Karners Biografie von Elise Richter behandelt werden. Sie führt von der Herkunft der jüdischen Familien Richter und Lackenbacher über die Kindheit von Helene und Elise bis zu deren Tod im Konzentrationslager Theresienstadt – wobei stets die Tagebücher im Zentrum stehen, aus denen durchgehend und dicht zitiert wird. So werden bisherige Forschungen oder Lesarten zu Elise Richters Biografie erweitert und neue Blickweisen auf die so wichtige Pionierin an der Universität Wien zur Diskussion gestellt. Weiterlesen ...
Die Buchpräsentation fand am 21. Jänner 2025 in der Wienbibliothek im Rathaus statt. Das Programm sowie einige Bilder davon finden sie unter diesem Link.
Kontakt für Anfragen zur Publikation: Christa Hämmerle: christa.haemmerle_univie.ac.at
Manfred Nowak und Edith Saurer Hg.: Vom Umgang mit den "Anderen" Historische und menschenrechtliche Perspektiven der Abschiebung
Herausgegeben von Manfred Nowak und Edith Saurer (1942-2011) unter Mitarbeit von Anna Müller-Funk und Brigitte Rath
in der Studienreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte Band 25 (2013) (Link)
Der Sammelband ist Ergebnis des interdisziplinären, gemeinsam mit der Forschungsplattform „Human Rights in an European Perspective“ im Dezember 2009 veranstalteten Workshop „Historische und menschenrechtliche Aspekte von Abschiebungen“.
Die Beiträge des 2013 veröffentlichten Buches machen deutlich, dass die Praxis der Abschiebung durchaus kein Phänomen der Moderne ist, sondern eine seit dem 18. Jahrhundert praktizierte Form des gewaltsamen Ausschlusses der „Anderen", die einen Einblick in die politische Kultur eines Landes eröffnet. Weiterlesen ...
Discussion about ERIH
2008 startete die European Science Foundation ihre Arbeit an den ERIH Initial Lists, die wissenschaftliche Zeitschriften "bewerten".
Im Salon 21 wurden Statements gesammelt, die als Rekation darauf 2009 veröffentlicht worden sind. Weiterlesen ...
Ist eine europäische Frauengeschichte möglich?
Im Internetforum Salon 21 wurde 2007 eine Diskussion zum Thema "Ist eine europäische Frauengeschichte möglich?" geführt. Die beim IV. Nationalen Kongress der Societá italinana delle storiche (SIS) von Angiolina Arru und Edith Saurer initiierte Debatte soll im virtuellen Raum weiter geführt werden. Weiterlesen ...
Sie sind herzlich eingeladen, die Beiträge von Éliane Viennot (französich), von Luisa Passerini (in deutscher Übersetzung) und Francisca de Haan (englisch), sowie die Kommentare von Edith Saurer und Michael Mitterauer zu lesen.
Diese Texte wurden im Salon 21 erweitert um die Verlinkung zu den Beiträgen, die seit 2009 im Themenportal Europäische Geschichte | Schwerpunkt Europäische Geschichte und Geschlechtergeschichte" veröffentlicht worden sind. Weiterlesen ...
In memoriam Edith Saurer (20.8.1942 ‒ 5.4.2011)
Am 5. April 2011 ist Edith Saurer, die Doyenne der österreichischen Frauen- und Geschlechtergeschichte, gestorben – viel zu früh, denn sie hatte noch so viel vor.
zum Nachruf auf Edith Saurer (PDF) | zur Parte (PDF)
Universitätsprofessorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien
Ihre Arbeit als Historikerin zeichnete sich durch stete Neugier und Offenheit sowie Lust am Risiko der Grenzüberschreitung aus. Sie verknüpfte innovatives Denken mit der Liebe zum Archiv, Kreativität mit Präzision. Eines ihrer Grundanliegen war die großzügige Förderung junger Menschen. Edith Saurer hat ihr Leben lang für Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung gekämpft.
An der Universität Wien wurde dieses Engagement dadurch sichtbar, dass sie seit den 1970er Jahren die Gleichbehandlungsgesetzgebung mitgestaltete. In Forschung und Lehre erreichte sie die Institutionalisierung des Schwerpunkts "Frauen- und Geschlechtergeschichte".
Sie war Mitbegründerin von "L'Homme. Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaften". Mit dieser Zeitschrift fanden Forschungsergebnisse der Frauen- und Geschlechtergeschichte internationale Anerkennung. Anfang der 1990er Jahre gründete sie mit ihren Schülerinnen und Mitarbeiterinnen die "Sammlung Frauennachlässe", ein europaweit einzigartiges Archiv, in dem bisher rund 180 Nachlässe wissenschaftlich aufbewahrt werden.
Sie initiierte und leitete die Forschungsplattform "Neuverortung der Frauen- und Geschlechtergeschichte im veränderten europäischen Kontext" an der Universität Wien. Edith Saurer verstand Wissenschaft auch als gesellschaftspolitischen Auftrag und hat sich in diesem Sinn immer wieder zu Wort gemeldet. Ihr Tod ist ein schmerzlicher Verlust für die Wissenschaft und die demokratische Öffentlichkeit.
Edith Saurer verstand Wissenschaft auch als gesellschaftspolitischen Auftrag
und hat sich in diesem Sinn immer wieder zu Wort gemeldet. Ihr Tod ist ein
schmerzlicher Verlust für die Wissenschaft und die demokratische
Öffentlichkeit.
Das Begräbnis findet am Freitag, den 15. April 2011, um 13 Uhr am Friedhof Gersthof, Möhnergasse 1, 1180 Wien, statt.
Erwin Thorn
Freundinnen und Freunde
Weitere Nachrufe:
- Regina Schulte, In memoriam Edith Saurer (20.8.1942–5.4.2011). Fantasie und Arbeit - auf den Spuren einer historischen Spurensucherin, in: L'HOMME. Z.F.G. 22, 1 (2011), 15-21.
- Erich Landsteiner, Margareth Lanzinger und Hans Medick, In memoriam Edith Saurer, in: Historische Anthropologie, 2 (2011), V-X.
- Angiolina Arru und Ruth Wodak, Una storica su due sponde, in: Genesis, IX/2 (2010), 251-254.
Für die Zukunft von "L'Homme. Z.F.G." und der "Sammlung Frauennachlässe" an der Universität Wien (2011)
Im März 2012 haben die Mitglieder der Forschungsplattform die folgende Petition initiiert. Der Aufruf stieß auf große Resonanz. Mittlerweile wurde die Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte institutionalisiert. Die Redaktion sowie der Druck der Zeitschrift L'Homme Z.F.G sind weiterhin auf Drittmittel angewiesen.
- -
Die Forschungsplattform Neuverortung der Frauen- und Geschlechtergeschichte im veränderten europäischen Kontext an der Universität Wien läuft in Kürze definitiv aus – und noch immer ist eine Zukunft der von 2006 bis 2011 in diesem Rahmen finanzierten Einrichtungen ungewiss. Die "Sammlung Frauennachlässe" und "L'Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft" sind dadurch akut gefährdet.
Link zur Online-Petition; English translation